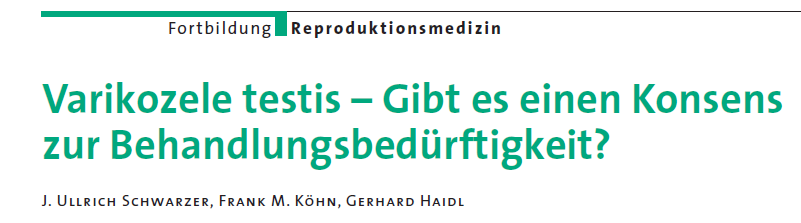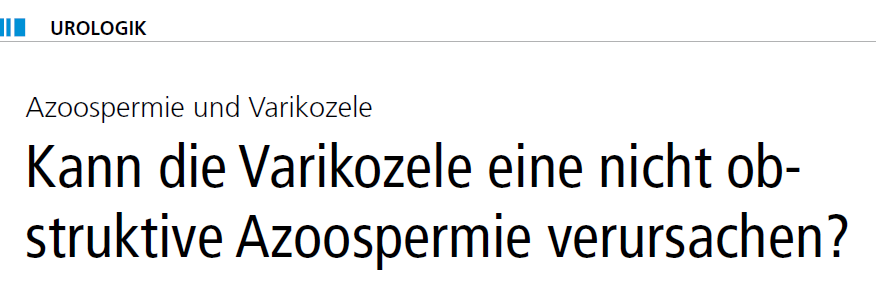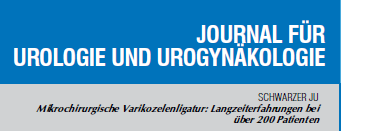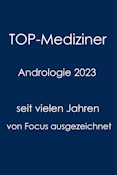Mikrochirurgische Varikozelenoperation
Eine Varikozele (=Krampfader) am Hoden liegt bei 10-15% aller Männer vor. Sie liegt fast immer auf der linken Seite vor und kann einen krankhaften Befund im Zusammenhang mit einer Fruchtbarkeitsstörung darstellen. So findet man bei bis zu 40% aller Männer mit unerfülltem Kinderwunsch eine Hodenkrampfader. Wenn man die Krampfader behandelt, erspart man dem Paar möglicherweise eine künstliche Befruchtung.
mehr unter:
www.kinderwunsch-mann.de
Was ist eine Varikozele (Hodenkrampfader) ?
Unter Varikozele versteht man die übermäßige Füllung eines bei jedem Mann im Bereich des Hodensackes vorhandenen Venengeflechtes (= plexus pampiniformis). Die Ursache der übermäßigen Füllung des Venengeflechtes liegt weiter oben in den Hodenvenen (selten nur eine Vene), die das Blut vom Hoden zurück zum Herzen transportieren. In diesen Venen befinden sich Klappen, die ein Zurückfließen des Blutes in die falsche Richtung verhindern sollen. Bei 10-15% aller Männer schließen diese Klappen nicht vollständig, so daß bei aufrechter Körperposition ein Teil des Blutes in den Venen zurück zum Hoden fließt (= Reflux) und so die übermäßige Füllung des o. g. Venengeflechtes bewirkt, was man als Varikozele bezeichnet. In sehr seltenen Fällen wirkt eine Raumforderung im Bereich des hinteren Bauchraumes (= Retroperitoneum) oder der Nieren als mechanisches Abflußhindernis und verursacht so eine Varikozele. Eine solche „symptomatische Varikozele“ ist sehr selten und tritt wenn, dann eher bei älteren Männern und nicht bei jungen Männern auf. Für die Tatsache des fast nur linksseitigen Auftretens einer Varikozele werden anatomische Gründe verantwortlich gemacht, so die Mündung der linksseitigen Hodenvene in die Nierenvene mit der Folge eines höheren Abflußwiderstandes.
Über den Mechanismus der möglichen Beeinträchtigung der Fruchtbarkeit durch die Varikozele gibt es zahlreiche Hypothesen, wobei die Erwärmung des Hodens durch die Krampfader eine Rolle spielen kann, vermutlich auch Druckänderungen in den Kapillaren des tubulären Systems im Hoden, aber die genauen Mechanismen sind bisher nicht eindeutig geklärt.
Behandlung einer Varikozele
Das Prinzip aller Therapieverfahren ist die Verhinderung des Rückflusses des Blutes in die falsche Richtung (= Reflux) in den Hodenvenen durch Verschluß oder Unterbindung dieser Venen. Somit resultieren aus jeder effektiven Varikozelentherapie zunächst mit Blut gefüllte Venen, deren Inhalt über Wochen bis Monate vom Körper abgebaut werden muß, so daß dann die krankhaft refluxiven Venen beseitigt sind. Das heißt, bei einer erfolgreichen Varikozelentherapie wird aus der vorhandenen „Refluxvarikozele“ eine sog. „Stauungsvarikozele“, die erst im Verlauf einiger Wochen bis Monate verschwindet. Unmittelbar nach dem Eingriff ist also für den Patienten noch keine Veränderung feststellbar, die blutgefüllte Krampfader ist noch vorhanden, nur wird diese nicht mehr durch den krankhaften Reflux von oben gefüllt.
Es gibt verschiedene Methoden der Varikozelentherapie, die wegen der hohen Rezidiv- bzw. Persistenzrate der Varikozele (d. h. die Varikozele kommt wieder oder sie wurde gar nicht beseitigt) sowie der z. T. nicht unerheblichen Komplikationsrate (z. B. Hydrozele = Wasserbruch) aus unserer Sicht und nach Einschätzung in vielen wissenschaftlichen Publikationen nicht mehr zeitgemäß erscheinen (retrograde Sklerosierung, hohe Ligatur nach Palomo oder Bernardi) und werden deshalb hier nicht erwähnt.
Die Methode der laparoskopischen Varikozelenligatur (= Bauchspiegelungstechnik) ist ein aufwendiges Verfahren mit nicht unerheblichen Risiken und möglichen Komplikationen, vor allem, weil der Ort des Venenverschlusses im hinteren Baumraum den alten Techniken der o. g. hohen Ligatur entspricht. Und diese Techniken haben den Nachteil der Unterbindung der Venen am falschen Ort, weil es oft unterhalb davon noch sog. ektope refluxive Venen gibt und deshalb der Operationseffekt meist sehr begrenzt ist und die Varikozele weiterhin durch einen Reflux von oben gefüllt wird. Ein zusätzlicher Nachteil der Laparoskopie ist das meist nicht selektive Verschließen der Vena testicularis, sondern das Setzen eines Clips auf die Vene und Arterie wie bei der alten Technik nach Palomo, was schnell geht, aber pathophysiologisch problematisch ist. So zeigen unsere Erfahrungen bei Patienten nach laparoskopischer Operation oft unbefriedigende Ergebnisse, so es nach unserer Meinung ein „Overtreatment“ mit bescheidenen Ergebnissen ist.
Eine wenig invasive und oft effektive Methode ist die in Deutschland früher häufig angewandte antegrade Sklerosierung, wo die Hodenvenen durch Einspritzen von „Sklerosierungsmittel“ von innen verschlossen werden. Dieses Verfahren ist nur mit Hilfe von Röntgenaufnahmen durchführbar und ist weniger erfolgreich als die mikrochirurgische Technik in Hand eines Experten. Vor allem bei sehr ausgeprägten drittgradigen Varikozelen ist die antegrade Sklerosierung oft nicht erfolgreich.
Die mikrochirurgische Varikozelenoperation ist ein sehr schonendes und effektives Verfahren. Dabei werden die Venen unter dem Operationsmikroskop unterbunden und gleichzeitig alle anderen Strukturen des Samenstranges sicher geschont, so daß die Effizienz sehr hoch ist bei gleichzeitig sehr niedriger Komplikationsrate. Diese Technik ist vor allem bei einem Rezidiv (Wiederauftreten oder Bleiben der Hodenkrampfader nach einem anderen Therapieverfahren) oft die einzig mögliche Behandlungsform. Deshalb kommen viele Patienten nach einer erfolglosen anderen Behandlungstechnik zur mikrochirurgischen Varikozelenligatur zu uns, weil Prof. Schwarzer der Experte für diese Operation ist.
Mikrochirurgische Varikozelenunterbindung
Der Eingriff wird in kurzer Vollnarkose durchgeführt (Dauer 45-60 min). Dabei wird ein kleiner Schnitt (ca. 4-5 cm) unterhalb der Leiste zur Darstellung des Samenstrangs angelegt. Dann werden die erweiterten Venen des Samenstrangs unter dem Operationsmikroskop unterbunden. Der große Vorteil dieser Methode ist das sehr schonende Vorgehen am richtigen Ort unmittelbar vor dem äußeren Leistenring mit Erfassung der ektopen Venen und sicherer Identifizierung aller Strukturen unter dem Operationsmikroskop. So können Arterien, Nerven und Lymphgefäße sicher identifiziert und geschont werden. Bei etwa 30 % der Patienten wird aufgrund der individuellen Venenanatomie der Leistenkanal geringfügig eröffnet und dann wieder verschlossen. Die Komplikationsrate des Verfahrens ist sehr gering (Nachblutung mit Bluterguß im Hoden 0,5 %, Wundinfektion <1 %, Hydrozelenbildung <0,1 %). Das Risiko einer unvollständigen Venenunterbindung oder des Neuauftretens einer Varikozele liegt an unserem Zentrum bei 6 %, also viel niedriger als bei allen anderen angewandten Methoden. Nach der Operation wird ein Druckverband am Hodensack für einen Tag angelegt. Die Naht wird mit versenkten Intracutannähten angelegt, die sich selbst auflösen. Nach der Operation sollte für zwei Wochen körperliche Belastung vermieden und für 4 Wochen kein Sport getrieben werden.